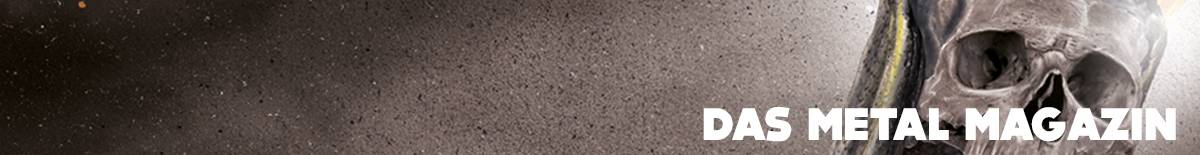Festivalname: Resurrection Fest
Bands: Judas Priest. Korn, Falling in Reverse, Slipknot, Jinjer, Till Lindemann, Tarja, Kanonenfieber, Pentagram, Soen, Municipal Waste, Russian Circle, Pentagram, Walls Of Jericho, Vader u.v.m.
Ort: Viveiro
Datum: 25.06. bis 28.06.2025
Kosten: 219 € VK
Genre: Heavy Metal, Thrash Metal, Metalcore, Hardcore, Death Metal
Besucher: ca. 30.000 Besucher
Veranstalter: Old Navy Port Producciones, SL
Link: https://www.resurrectionfest.es/
Das Resurrection Fest im galicischen Viveiro führt hierzulande noch ein Schattendasein – zu Unrecht. Mit Headlinern wie Korn, Slipknot oder Judas Priest spielt das Line-Up locker in einer Liga mit dem Hellfest und Wacken. Verstecken muss sich hier niemand.
Ein Grund, warum sich bislang nur wenige internationale Gäste aufs Resurrection verirren, ist die Lage. Die Atlantikküste im Nordwesten Spaniens ist zwar wunderschön – und einen verkaterten Festivaltag am Strand zu beginnen, ist ein Luxus, den man nur ungern wieder hergibt, wenn man ihn einmal erlebt hat. Aber Galicien liegt eben auch verdammt weit ab vom Schuss. Portugal vielleicht ausgenommen, ist man von so ziemlich jedem anderen Land in Europa eine halbe Weltreise entfernt. Ich selbst reise aus Bilbao an und selbst mit dem Auto sind das gute fünf Stunden.
Nach der Ankunft heißt es erst mal: Lager aufschlagen. Und hier zeigt sich ein Problemchen, das sich durchs ganze Resurrection Fest zieht: Nichts gibt’s umsonst. Zumindest fast nichts. Offiziell existiert zwar ein kostenloses Camp, aber die Plätze dort sind begrenzt. Und wenn die weg sind, sind sie eben weg.
Stellplatz heißt hier: fürs Zelt. Das Auto muss separat irgendwo in Viveiro geparkt werden. Trotz reserviertem Zeltplatz reise ich also in aller Herrgottsfrühe an, um einen der begehrten kostenlosen Parkplätze zu ergattern. Wer zu spät kommt, tja, der zahlt. Für einen kostenpflichtigen Platz werden leicht 20 Euro fällig.
Ich finde tatsächlich einen kostenlosen Parkplatz und schleppe mein Gepäck zum Resu Camp. Dort wartet die nächste Überraschung: Die reservierten Parzellen sind fein säuberlich auf dem Boden abgesteckt. Und zwar so knapp bemessen, dass gerade ein handelsübliches Zweimannzelt hineinpasst. Wer mit größerem Zelt, Pavillon oder gar einer Bierzeltgarnitur anrückt, muss gleich doppelt zahlen, sprich: einen zweiten Platz reservieren. Typisch spanisch irgendwie: maximale Bürokratie bei minimaler Effizienz.
Aber genug der Vorrede, kommen wir zur Musik. Den Auftakt auf der Main Stage bestreiten From Fall To Spring. Ein undankbarer Slot: zu früh, zu hell, zu nüchtern. Aber die Jungs aus Deutschland nehmen’s sportlich und machen das Beste draus. Zwei Sänger, zwei Stimmen – cleaner Gesang trifft auf Screams, Metalcore auf Pop-Appeal. Zwischendrin gibt’s eine Anekdote über den gescheiterten Versuch, beim Eurovision Song Contest mitzumischen. Zum Schluss dann ein Cover von In The End. Kein Abriss, aber ein solider Start in vier Tage Lärm.
From Fall To Spring stecken außerdem ganz gut den Rahmen ab, was man auf dem Resurrection Fest geboten bekommt. Viele der kleineren und mittleren Bands kommen aus der moderneren Ecke – irgendwo zwischen Metalcore, Hardcore und eingestreutem Pop-Appeal. Wer’s oldschool will, muss sich gedulden.
Ganz und gar nicht mehr oldschool sind Lost Society, die am späten Nachmittag die Ritual Stage bespielen (das ist die zweitgrößte Bühne des Festivals). Die Finnen haben mal als Thrash-Abrisstruppe mit 80er-Vibe angefangen, doch dann kam Corona. Was nach der Zwangspause zurückkam, war eine Pop-Metalcore-Band mit Emo-Touch und melancholischem Pathos. Mich lässt das, was die Jungs jetzt abliefern, eher ratlos bis belustigt zurück, aber sie scheinen tatsächlich einige Fans zu haben.
Modern geht’s auch bei Jinjer zu, dem ersten echten Highlight des Tages – zumindest für alle, die mit ihrer Musik etwas anfangen können. Ich gehöre nicht ganz dazu und ziehe es vor, mir das Spektakel aus sicherer Distanz anzusehen. Tatiana Shmayluk und ihre Jungs liefern eine durchgetaktete Show ab, technisch auf Zack, mit viel Druck und wechselnden Gesangsstilen. Das Publikum frisst ihnen jedenfalls aus der Hand. Solide gespielt, gut inszeniert, die Fans kommen auf ihre Kosten.
Nach all dem modernen Kram wird’s Zeit für ein bisschen Tradition. Und die kommt mit Ansage – und großem Besteck. Judas Priest betreten die Bühne, und damit eine der einflussreichsten Heavy-Metal-Bands überhaupt. Die Galicier haben nicht gekleckert, sondern geklotzt: Headliner-Material für den letzten Abend. Der geneigte Hörer bekommt, was er erwartet. Rob Halford steht in Leder da, behangen mit Nieten. Painkiller, Breaking The Law, You’ve Got Another Thing Comin’ – alles dabei, alles sitzt. Die Gitarrenarbeit messerscharf, das Schlagzeug wuchtet, das Publikum grölt die Refrains in den Abendhimmel. Und natürlich fährt Halford gegen Ende stilecht mit seiner Harley auf die Bühne. Ein bisschen albern? Vielleicht. Aber auch genau das, was es sein soll: großes Kino für Metal-Traditionalisten. Der Auftritt sitzt – und zwar fest.

Große Festivals bedeuten auch immer: schwere Entscheidungen. So viele Bühnen, so viele Bands und nie genug Zeit. Also bleibt mir nur die erste Hälfte von Tarjas Auftritt auf der Ritual Stage. Was ich sehe (und höre), reicht aber für ein klares Fazit: Die Frau weiß noch immer ganz genau, was sie tut. Ihr glockenheller Sopran ist auch mit knapp 50 noch beeindruckend. Dazu gibt’s opulente Outfits, dramatische Gesten und eine Lichtshow, die eher Oper als Underground ist. Klar, wer mit Nightwish gar nichts anfangen kann, wird hier nicht plötzlich bekehrt. Aber wer Tarja hören will, bekommt sie in Bestform.
Dann mache ich mich auf den Weg zur Desert Stage. Der Name ist Programm, hier gibt’s in erster Linie Doom Metal und Stoner Rock zu hören. An diesem Abend sind Pentagram das Highlight. Musikalisch ist das alles solide, aber vor allem zeigt der Auftritt die Macht von Social Media. Vor ein paar Monaten traten die Jungs noch vor einem kleinen Kreis hartgesottener Fans auf. Dass TikTok und Instagram mit Memes über Bobby Liebling geflutet wurden, haben für einen derartigen Popularitätsschub gesorgt, dass die Resurrection–Fest-Besucher sogar die Dixi-Klos besteigen, um einen Blick auf die Bühne zu erhaschen. Mir ist das zu viel des Guten und deswegen trete ich nach einigen Songs den Rückzug an, die heimische Parzelle lockt.
Nach einer geruhsamen Nacht im Resu Camp geht’s zurück Richtung Infield. Klingt einfach, ist es aber nicht. Denn das Resurrection Fest verteilt sich großzügig über die gesamte Stadt. Die Bühnen liegen zwar in einem abgeschlossenen Areal, aber die Campingplätze sind dezentral verstreut. In meinem Fall heißt das: eine gute Dreiviertelstunde Fußmarsch oder anstehen für den Shuttlebus. Der Bus ist (ihr erinnert euch an die Einleitung) wie so ziemlich alles hier natürlich nicht kostenlos. 1,50 Euro pro Fahrt. Kleinvieh macht auch Mist. Wer sparen will, geht zu Fuß. Wer Kräfte schonen will, zahlt. Irgendwas ist immer. Heute entscheide ich mich fürs Gehen, obwohl die Sonne bereits kräftig auf die nordspanische Küste brennt.
Die Mühen lohnen sich aber definitiv, denn heute stehen gleich mehrere Hochkaräter auf dem Programm. Ich lasse es dennoch ruhig angehen und gönne mir zunächst ein bisschen Doom Metal auf der Desert Stage. Messa sind aus Venetien angereist und liefern einen soliden Auftritt ab. Dazu gibt’s das erste Bier, man muss schließlich auf Betriebstemperatur kommen.
So gestärkt wird es Zeit für härtere Klänge, mit Death Angel hat das Resurrection Fest hier genau das Richtige im Programm.

Und so gibt’s auf der Ritual Stage Bay-Area-Thrash wie aus dem Lehrbuch. Rob Cavestany zersägt sein Griffbrett, Mark Osegueda keift, schreit und trägt die Show mit pathosfreier Souveränität.
Auf der Main Stage wird’s danach wieder modern. Seven Hours After Violet stehen auf dem Programm – ein Name, der mir bis dato nichts sagte. Dabei steckt niemand Geringeres dahinter als Shavarsh „Shavo“ Odadjian, Bassist von System Of A Down. Trotz dieses prominenten Backgrounds will der Funke bei mir nicht so recht überspringen. Die Mischung aus Metalcore, Melodie und Breakdowns wirkt auf mich wie aus dem Baukasten, ordentlich gespielt, aber ohne Ecken. Vielleicht liegt’s an mir, vielleicht am Sound. Was man der Band allerdings lassen muss: Obwohl erst 2024 gegründet, hat sie schon eine respektable Fanbasis im Gepäck. Die Reihen vor der Bühne sind dicht, die Hände in der Luft, die Energie spürbar. Ich bleibe skeptisch, aber offenbar bin ich in der Minderheit.

Was danach auf der Ritual Stage geboten wird, trifft schon eher meinen Geschmack. Municipal Waste geben sich die Ehre und wer die Truppe kennt, weiß, was jetzt kommt: Thrash trifft Punk trifft Abrissbirne. Die Crossover-Recken aus Richmond, Virginia, verschwenden keine Zeit mit Aufwärmen. Schon beim ersten Riff springt der Funke über, die Meute tobt, der Staub steht in der Luft. Sadistic Magician, The Art Of Partying, Born To Party – Hits gibt’s genug, aber eigentlich ist bei denen jeder Song ein Hit, weil alles nach vorne geht, alles kurz, laut, direkt. Crowdsurfer fliegen im Minutentakt über die Wellenbrecher, der Pit dreht durch, Bierduschen inklusive. Hier wird nicht musiziert, hier wird gefeiert. Municipal Waste machen keine Kompromisse und liefern exakt das, was man von ihnen erwartet: Energie, Tempo, Chaos und ein fettes Grinsen im Gesicht.

Till Lindemann braucht keine Vorstellung. Wer ihn nicht kennt, ist hier sowieso falsch. Was er auf der Main Stage serviert, ist eine Mischung aus Industrial, Kabarett, Theater und provokanter Groteske. Ein Zirkus der Abgründe, rot kostümiert und maximal inszeniert. Stripper-Stange und knappe Lederoutfits an den weiblichen Mitgliedern der Begleitband; Lindemann weiß, wie man mit schlechter Presse umgeht. Der Protagonist selbst schreitet wie ein dämonischer Conférencier durch sein Szenario aus Lust, Gewalt und Untergang. Zwischen stampfenden Industrialnummern nimmt er sich Zeit für kleine Einlagen und bewirft das Publikum beispielsweise mit toten Fischen. Doch ein Gespür für sein Publikum hat der Schock-Rocker definitiv: Mit einem Cover des Heroes-Del-Silencio-Hits Entre Dos Tierras zieht er die Spanier mühelos auf seine Seite.
Korn haben eine Rechnung offen. 2022 mussten sie ihre Show kurzfristig absagen – ein Makel, der vielen Fans noch in den Knochen steckt. Dieses Jahr kehren sie zurück nach Viveiro, um genau das auszubügeln. Schon vor dem ersten Ton ist klar, wem der Abend gehört: Das schwarze Tuch vor dem Main Stage fällt, Blind kracht los, Jonathan Davis schreit sein ikonisches „Are you ready?“ – und die Antwort kommt aus tausenden Kehlen. Die Show ist monumental: fünf bewegliche Lichtpanels fluten die Bühne mit Texturen, Farben, Atmosphäre. Davis wandert, spielt Gitarre, singt sich durch Jahrzehnte Bandgeschichte, gestützt auf seinen stilisierten Mikrofonständer. Die Setlist ist ein Ritt durch das eigene Vermächtnis – Got The Life, Shoots and Ladders (inklusive One-Outro von Metallica), Divine, Freak On A Leash. Head, Munky, Ra Díaz und Ray Luzier liefern ein rhythmisches Fundament, das so fett wie präzise ist. Es ist eine dieser Shows, bei der selbst das größte Gedränge nicht stört, weil alles stimmt: Licht, Sound, Energie, Timing.
Nach so einem Schlusspunkt soll man sich nicht von Nebensächlichkeiten aufhalten lassen. Deshalb geht’s ab ins Bett (bzw. auf die Luftmatratze), um für einen weiteren Festivaltag gerüstet zu sein.
Die Parzelle auf dem Resu Camp kostet zwar, bringt aber auch echte Vorteile. Zu Fuß ist man in ein paar Minuten am Strand. Und der hat mehr zu bieten als Salzwasser und Meeresrauschen. Direkt an der Küste steht ein Chiringuito, eine dieser charma
Auch eine Band wie Broken By The Scream sieht man nicht alle Tage. Vier japanische Sängerinnen, zwei davon mit opernhaftem Clean-Gesang, zwei mit kreischenden Growls. Das alles über einer instrumentalen Soundwand aus Metalcore, Tech-Metal und J-Pop-Melodien. Gewöhnungsbedürftig? Auf jeden Fall. Aber wer sich drauf einlässt, erlebt eine schrille Mischung aus Hochglanz-Idolästhetik und brachialem Soundgewitter. Ob’s gefällt, sei dahingestellt – witzig anzusehen ist es allemal.
Party Cannon halten, was der Name verspricht. Buntes Logo im Toys’R’Us-Stil, quietschige Badeenten auf der Bühne, dazu brutalster Slam Death Metal, der alles über den Haufen walzt. Das ist Trash mit Anlauf, aber extrem tight gespielt und voller Selbstironie. Die Band liefert eine „Party“, wie man sie auf einem Metal-Festival gerne sieht: absurd, laut, verdammt unterhaltsam.
Ganz andere Töne schlägt da die Supergroup Soen an. Die Band um den früheren Opeth-Schlagzeuger Martin Lopez ist progressiv, melancholisch, atmosphärisch. Auf der Bühne zeigt sie eine Balance aus technischer Finesse und emotionalem Tiefgang. Die Songs bauen sich langsam auf, wachsen, brechen auf, verfallen wieder in Stille. Nichts ist hier überhastet oder plakativ. Ein Ruhepol zwischen all dem Geballer, aber kein Leerlauf.

Nach diesem Ausflug in modernere Gefilde wird’s noch mal oldschoolig, diesmal aber mit einer heimischen Band. Angelus Apatrida sind eine Bank. Solider Thrash aus Spanien, kompromisslos, laut, mit Eiern. Keine Showeffekte, kein Schnickschnack. Einfach vier Typen, die ihre Instrumente beherrschen und das Publikum direkt abholen. Wer Slayer oder Testament mag, bekommt hier genau das, was er sucht. Kein Wow-Effekt, aber ein ehrlicher, packender Abschluss für alle, die lieber mit dem Nacken als mit dem Handy feiern.
Auch am vierten und letzten Festivaltag gibt die galicische Sonne alles. Es ist heiß im Resu Camp. Abkühlung versprechen die kühlen Getränke, die es an der Bar des Zeltplatzes gibt. Hier ist allerdings eine weitere kleine „Eigenheit“ des Resurrection Fests zu beachten: Auf dem Konzertgelände bezahlt man – wie bei vielen großen Festivals – ganz einfach mit NFC-Armband. Das kann über zahlreiche Terminals überall auf dem Gelände mit Kreditkarte und sogar Bargeld geladen werden. Das und die tatsächlich einigermaßen fairen Preise machen das Bezahlen zum Hochgenuss. Dieses Bezahlsystem funktioniert allerdings nicht auf dem Campingplatz. Hier muss man Plastikchips kaufen, die man dann wiederum gegen Bier, Tortilla oder Eiscreme tauschen kann. Den Shuttlebus wieder MUSS man mit Bargeld an einem Schalter zahlen. Direkt beim Busfahrer zahlen? Fehlanzeige.
Den Bus nehme ich heute auch, um mir die Grind-Chaoten Gutalax anzusehen. Wobei Grindcore fast schon euphemistisch ist angesichts des stumpfen Geknüppels, das die Tschechen von der Main Stage kloppen. Dazu gibt’s jede Menge Klohumor. Das soll aber nicht heißen, dass man hier nicht auf seine Kosten kommt. Die Jungs unterhalten. Eigenwillig, aber sie unterhalten. Der Pit dreht trotz der Hitze bereits ordentlich durch, Einhornkostüme und Klobürsten gibt’s obendrauf.
Ganz anders, aber ebenso willkommen: Slomosa. Die Norweger spielen Stoner-Rock, wie aus der Zeit gefallen. Schwer, aber nicht stumpf. Dichte Riffs, warme Sounds, dazu diese nordische Gelassenheit. Die Sonne hängt tief, das Tempo auch.

Russian Circles bauen keinen Song – sie bauen Räume. Ihre instrumentale Wall of Sound hat etwas Erhabenes, fast religiöses. Kein Wort, kein Gesang. Nur Klangflächen, Schicht um Schicht, bis man fast vergisst, dass das hier eigentlich ein Lärmfestival ist. Einer der magischsten Momente des ganzen Wochenendes. Still stehen. Lauschen. Versinken.
Dann Hardcore ohne Kompromisse. Walls Of Jericho knallen los, als gäb’s kein Morgen. Candace Kucsulain vorneweg, eine Frontfrau mit messerscharfer Stimme und Faust in der Luft. Das Chaos ist organisiert, die Wut ist echt. Kein Schnickschnack, keine Pose – nur Druck.
Als großes Finale betreten Slipknot die Bühne. Die Masken sitzen, der Platz ist voll. Corey Taylor schreit sich die Seele aus dem Leib, Flammen schießen, die Bühne brennt. Wait And Bleed, Psychosocial, Surfacing – alles dabei. Es ist nicht die beste Show ihrer Karriere, aber eine, die sich ins Gedächtnis brennt. Am Ende dann: Scissors. Kein idealer Schlusspunkt, aber irgendwie passend. Danach: Feuerwerk. Applaus. Und dann diese plötzliche Stille, in der einem klar wird, dass es vorbei ist. Für mich endet das Resurrection Fest an dieser Stelle, ich trete den langen Rückweg in heimische Gefilde an. Auch wenn das Festival so einige Eigenheiten bereithält – es lohnt sich.